In der Apotheke werden PTA mit den unterschiedlichsten Themen konfrontiert. Lesen Sie hier die tagesaktuellen News aus den Bereichen Pharmazie, Forschung, Ernährung, Gesundheit und vielem mehr. Bleiben Sie informiert, um Ihre Kunden stets kompetent zu beraten.
Lipid-Werte: Wann sollten sie gesenkt werden?
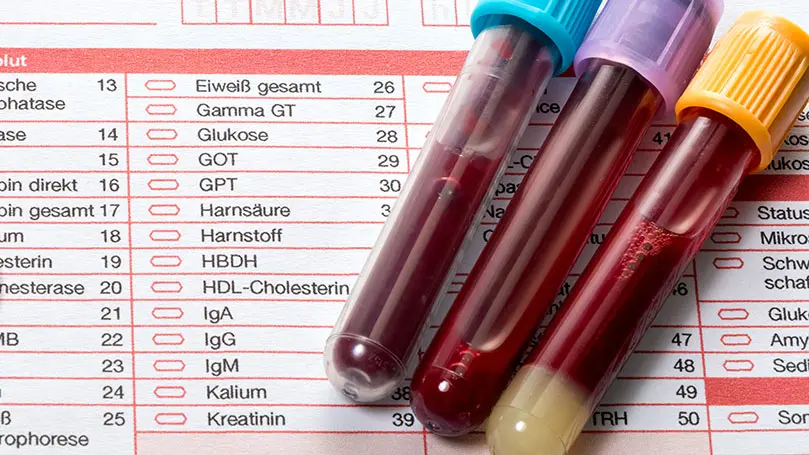
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die führende Todesursache in Deutschland. Sie sind insgesamt für etwa 40 % aller Sterbefälle verantwortlich.
Um diesem Problem zu begegnen, wollte der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit dem sogenannten Gesundes-Herz-Gesetz (GHG) eine Grundlage schaffen, um kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Personen früher zu erkennen und Therapien zu verbessern. Ein geplanter Schwerpunkt war auch, kardiovaskulären Ereignissen vorzubeugen.
Mit dem Bruch der Ampelkoalition scheiterte das GHG. Über den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) konnte durch Änderung der Anlage III der Arzneimittel-Richtlinie die Idee gerettet werden, lipidsenkende Arzneimittel wie Statine „früher“ zu verordnen.
Wann sollen Statine früher verordnet werden?
Konkret heißt das: Patienten, die ein Risiko von mindestens 10 % haben, innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, dürfen Arzneimittel wie Statine verordnet bekommen. Zuvor lag die Schwelle bei einem mindestens 20%igen Risiko.
Doch welche Faktoren bestimmen das kardiovaskuläre Risiko, wie kann es berechnet werden und welche Grenzwerte sollen bei den Lipid-Werten eingehalten werden?
Gut zu wissen: Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
In einer großen Analyse von 2023 haben Forschende des Global Cardiovascular Risk Consortium fünf modifizierbare Risikofaktoren identifiziert, die für rund 55 % der kardiovaskulären Risiken verantwortlich sind:
Die gute Nachricht ist: Wer mit 50 ein gesundes Leben führt und alle fünf Risikofaktoren unter Kontrolle hat, gewinnt mehr als ein Jahrzehnt an Lebenszeit verglichen mit Personen, bei denen alle fünf Faktoren aus dem Ruder gelaufen sind.
Kardiovaskuläres Ereignis: Risikoberechnung mit dem SCORE2
In Europa kann das Risiko, ein fatales oder nicht fatales kardiovaskuläres Ereignis (Myokardinfarkt, Schlaganfall) in den nächsten zehn Jahren zu erleiden oder an einem kardiovaskulär bedingten Tod zu sterben, mit dem sogenannten SCORE2 (Systematic COronary Risk Evaluation 2) berechnet werden. Er wurde für vier Risikoregionen (niedrig, moderat, hoch, sehr hoch) nach länderspezifischer Mortalität für Herz-Kreislauf-Erkrankungen definiert.
Deutschland zählt dabei zu den Ländern mit moderatem Risiko. Als Variablen gehen Alter, Geschlecht, systolischer Blutdruck, Gesamtcholesterol, HDL-Werte und Raucherstatus in den SCORE2 ein.
Dieser kann online berechnet werden. Allerdings ist er nur für gesunde Personen im Alter von 40 bis 69 bzw. von 70 bis 89 Jahren (SCORE2OP, OP = older persons) gedacht und nicht für Schwangere sowie Patienten mit atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen Risikoerkrankungen wie Diabetes mellitus, familiärer Hypercholesterolämie oder chronischer Nierenerkrankung.
Patienten mit klinisch manifesten kardiovaskulären Erkrankungen wie einem erlittenen Herzinfarkt, Schlaganfall oder instabiler Angina pectoris zählen grundsätzlich zur Gruppe mit hohem oder sehr hohem Risiko. Ebenso zählen dazu asymptomatische Patienten mit Atherosklerose oder langjährigem Diabetes mellitus, familiärer Hyperlipidämie, hohem Lipoprotein (a) (Lp(a)) und chronischer Niereninsuffizienz.
Was empfiehlt die Leitlinie?
In der Dyslipoproteinämie-Leitlinie der European Society of Cardiology (ESC) und European Atherosclerosis Society (EAS) von 2019 wird empfohlen, dass erwachsene Männer über 40 und Frauen über 50 ein Risikofaktoren-Screening in Betracht ziehen.
Mit Blick auf die Zielparameter bei den Blutfetten ist der LDL-Cholesterol-Wert (LDL-C) am wichtigsten. Laut Leitlinie wird empfohlen, LDL-C-Werte so weit wie möglich zu senken, zumindest bei Patienten mit sehr hohem kardiovaskulärem Risiko.
Denn in Metaanalysen wurde gezeigt, je höher der LDL-C-Wert absolut gesenkt wird, umso mehr verringert sich das kardiovaskuläre Risiko. Grundsätzlich gelten beim LDL-C laut der Leitlinie folgende Zielwerte:
- Alle Personen mit einem sehr hohen kardiovaskulären Grundrisiko sollen ihren Ausgangswert um mindestens 50 % senken und einen LDL-C-Zielwert < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l) anstreben. Bei Patienten, bei denen unter einer maximal tolerierten Statin-Dosis innerhalb von zwei Jahren erneut ein kardiovaskuläres Ereignis auftritt, soll das LDL-Cholesterol sogar auf < 40 mg/dl gesenkt werden.
- Für Personen mit einem hohen Risiko gilt ebenso eine 50%ige Senkung des Ausgangswerts und ein LDL-C-Zielwert kleiner 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l).
- Bei moderatem Risiko gilt ein Wert von < 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l).
- Bei niedrigem Risiko soll ein LDL-C-Zielwert < 116 mg/dl (< 3,0 mmol/l) eingehalten werden.
Wie kann der LDL-C-Wert gesenkt werden?
Lebensstilveränderungen sind die Basis, um kardiovaskuläre Risiken zu senken. Dazu gehören Nichtrauchen, fettarme Ernährung, Bewegung sowie ein BMI zwischen 20 und 25 kg/m2 bzw. ein Taillenumfang von < 94 cm bei Männern und von < 80 cm bei Frauen. Allerdings ist durch diese Maßnahmen nur eine LDL-Senkung von allenfalls 10 bis 15 % zu erwarten.
Um die LDL-C-Zielwerte zu erreichen, ist oftmals eine Arzneimitteltherapie angezeigt. Statine (hochpotent und hochdosiert) sind zunächst Mittel der Wahl, im nächsten Schritt kann Ezetimib ergänzt werden, in einem weiteren Bempedoinsäure.
Sind die LDL-C-Spiegel auch dann noch nicht im grünen Bereich, kann ein Proproteinkonvertase-Subtilisin/Kexin-Typ- 9(PCSK9)-Inhibitor eingesetzt werden wie Alirocumab und Evolocumab oder Inclisiran.
Risikofaktor Lipoprotein (a) für kardiovaskuläre Ereignisse
Als weitere Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse gelten unter anderem die Werte von triglyceridreichen Lipoproteinen, Remnant-Cholesterol(Chylomikronen, Very Low Density Lipoproteine [VLDL], Intermediate Density Lipoproteine [IDL]) und Lipoprotein (a) (Lp(a)) sowie Entzündungen (erhöhte CRP-Werte).
Besonderen Stellenwert nimmt dabei Lipoprotein (a) ein. Bei einem Drittel der europäischen Bevölkerung liegen die Serumspiegel oberhalb des Grenzwertes von 30 mg/dl. Lp(a) wird in der Leber gebildet, ist ein LDL-ähnliches Molekül und wirkt deutlich atherogener (Atherosklerose hervorrufend) als ein LDL-Cholesterol-Partikel.
Zwar überwiegen bei den meisten Menschen LDL-Partikel gegenüber Lp(a)-Partikeln – LDL trägt deshalb mehr zum kardiovaskulären Gesamtrisiko bei – doch bei erhöhten Spiegeln kann Lp(a) gefährlich werden.
Deshalb sollten Erwachsene ihre Lp(a)-Konzentration einmal im Leben bestimmen lassen. Verantwortlich für erhöhte Lp(a)-Werte ist die Genetik. Sport oder gesunde Ernährung haben keinen Einfluss auf die Spiegel.
Bisher gibt es noch keine zugelassenen Arzneimitteltherapien zur Lp(a)-Senkung, weshalb Patienten mit erhöhten Werten die modifizierbaren Risiken gering halten sollten.
Gut zu wissen: Was sagt die Leitlinie zu Triglycerid?
Mit Blick auf Triglycerid-Werte wird in der ESC/EAS-Leitlinie kein Ziel vorgegeben. Ein Wert unter < 150 mg/dl (< 1,7 mmol/l) weist auf ein geringes kardiovaskuläres Risiko hin.
Eine medikamentöse Therapie der Hypertriglyceridämie kann bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko und Triglycerid-Werten über 200 mg/dl (2,3 mmol/l) trotz Anpassung des Lebensstils erwogen werden. Auch hier werden Statine als medikamentöse Therapie der Wahl eingesetzt.
Hilfreich: ApoB-Werte bestimmen lassen
Der Hauptbestandteil der Lipoproteine geringer Dichte ist Apolipoprotein B (ApoB). Deshalb ermöglicht eine Bestimmung der ApoB-Spiegel, alle atherogenen LipoproteineLDL-C, triglyceridreiche Lipoproteine und Lipoprotein (a) abzuschätzen. In der ESC/EAS-Leitlinie zur Dyslipidämie werden auch Zielwerte für ApoB angegeben.
Folgende ApoB-Zielwerte gelten für Personen mit entsprechenden kardiovaskulären Risiken:
- sehr hoch: < 65 mg/dl,
- hoch < 80 mg/dl und
- moderat < 100 mg/dl
Ebenfalls angegeben werden in der Leitlinie Werte für das Gesamtcholesterol ohne HDL (Nicht-HDL-C-Zielwerte) mit Werten unter 85 mg/dl bei sehr hohem, 100 mg/dl bei hohem und 130 mg/dl bei moderatem Risiko. www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Journal-of-Health-Monitoring/GBEDownloadsJ/Focus/JHealthMonit_2025_02_Herz-Kreislauf-Erkrankung.html
www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/bundeskabinett-beschliesst-gesundes-herz-gesetz-pm-28-08-2024.html
www.g-ba.de/downloads/39-261-6970/2024-12-19_AM-RL-III_Nr35-Lipidsenker_BAnz.pdf
doi: 10.1056/NEJMoa2206916
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab309
www.heartscore.org/en_GB
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455
[8] Neue europäische „Leitlinie“ zur Lipidsenkung: As low as possible? Arzneiverordnung in der Praxis der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), Band 47 Heft 1 bis 2, Stand: März 2020
https://www.lipid-liga.de/empfehlungen/
https://leitlinien.dgk.org/2020/pocket-leitlinie-diagnostik-und-therapie-der-dyslipidaemien-version-2019/
https://leitlinien.dgk.org/files/2020_kommentar_dyslipdidaemie_ow.pdf
doi: 10.1016/j.ejim.2023.10.013.
https://herzmedizin.de/meta/presse/dgk-jahrestagung/2025/statements-der-dgk-pressekonferenzen/lipoprotein-a-der-unterschaetzte-risikofaktor.html
DOI: 10.1056/NEJMoa2415879